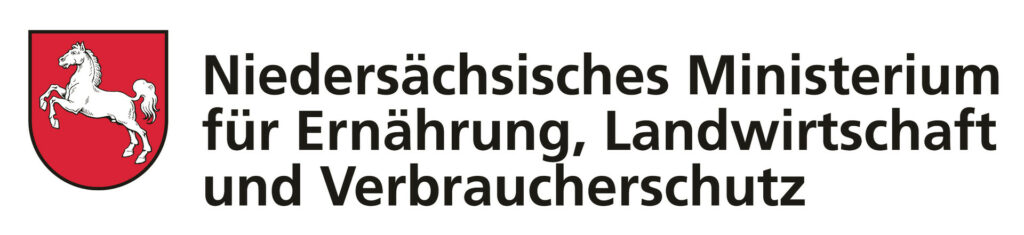Rückblick auf das Vernetzungstreffen „Vielfältiger Acker“
Beratung für Biodiversität und Pflanzenbau weiterdenken – Austausch von Praxis, Beratung und Politik
Wie können Ackerbau und Biodiversität Hand in Hand gehen? Welche Rolle spielt die Beratung dabei – und wie kann sie stärker vernetzt und praxisorientiert gestaltet werden? Diese Fragen standen im Mittelpunkt des dritten niedersächsischen Vernetzungstreffens zum Thema „Vielfältiger Acker“, das am 4. September 2025 in den Räumen der Landwirtschaftskammer Niedersachsen stattfand. Rund 60 Teilnehmende aus Praxis, Beratung, Forschung, Politik und Verbänden kamen zusammen, um Erfahrungen auszutauschen, Synergien auszuloten und gemeinsam Lösungsansätze für mehr Biodiversität im Ackerbau zu erarbeiten. Im Mittelpunkt der gemeinsamen Veranstaltung von LWK Niedersachsen und Ackerbauzentrum Niedersachsen stand der fachliche Austausch für eine stärkere Verzahnung der Beratung in den Bereichen Biodiversität und Pflanzenbau.


Strategische Bedeutung biodiversitätsfördernder Beratung
Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte unterstrich in ihrer Begrüßung die Bedeutung des Austausches für die Umsetzung der Ziele des Niedersächsischen Weges: „Die Förderung der Beratung zum Biotop- und Artenschutz ist ein zentrales Instrument des Niedersächsischen Weges. Eine solche Beratung muss zukünftig ebenso selbstverständlich sein wie eine produktionsorientierte Ackerbauberatung – beides muss Hand in Hand gehen.“
Manfred Tannen, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, betonte in seinem Grußwort die Notwendigkeit, Biodiversität stärker als integralen Bestandteil betrieblicher Entscheidungen zu verstehen: „Biodiversitätsförderung in der Agrarlandschaft kann nicht losgelöst von der betrieblichen Ebene gedacht werden. Wir müssen im Dialog praxisnahe und wirtschaftlich tragfähige Lösungen entwickeln.“
Einordnung durch das Ackerbauzentrum
Hilmar Freiherr von Münchhausen, Leiter des Ackerbauzentrums Niedersachsen wies in seiner Einführung darauf hin, dass in der Beratung große Chancen liegen, um die Betriebe für ein „Mehr“ an Biodiversität zu motivieren. Dafür sei es wichtig, diese gesellschaftlich nachgefragte Leistung auch entsprechend zu honorieren. Bei der Beratung müssten die Perspektiven und Ziele des Pflanzenbaus, des Förderrechts und des Arten- und Naturschutzes enger miteinander verzahnt werden. Es gilt Zielkonflikte ebenso aufzuzeigen wie Win-win-Situationen, die sich u.a. durch technische Innovationen oder veränderte Marktbedingungen ergeben.

Fachimpulse aus Forschung und Praxis am Vormittag
Drei Fachvorträge bildeten die Grundlage für die anschließende Diskussion:
Carolin Rudolf und Hannah Weets (AG bäuerliche Landwirtschaft Mitteldeutschland e.V.) stellten Maßnahmen zur Förderung von Nützlingen im Ackerbau vor. Blühstreifen, die speziell auf die Bedarfe kulturspezifischer Nützlinge angepasst sind und nicht nur in Randstrukturen, sondern auch auf dem Acker platziert werden, werden im Rahmen des Projekts „Gezielte Insektenförderung für die Landwirtschaft“ als wirksame Strategie zur Schädlingsregulierung erprobt.
Dr. Astrid Thorwest (NLWKN) stellte in ihrem Vortrag die Rolle von Ackerwildkräutern als Bestandteil der Kulturlandschaft dar. Sie betonte, dass verschiedene Ackerwildkrautarten nach der Roten Liste gefährdet sind und zeigte auf, welche Arten aus ackerbaulich Sicht besonders problematisch und damit auch regulierungswürdig seien.
Dr. Lena Ulber (Julius Kühn-Institut) präsentierte technische Innovationen zur differenzierten und teilflächenspezifischen Unkrautregulierung. Durch smarte, technische Lösungen könnten zukünftig die Ertragssicherheit und der Erhalt wertvoller Ackerbegleitarten kombiniert werden.


Praxisbezogene Diskussion in den Workshops am Nachmittag
In zwei parallellaufenden Workshops wurden die fachlichen Inhalte mit den Teilnehmenden weitergehend diskutiert.
Workshop 1 beleuchtete zukünftige Entwicklungen im konventionellen und ökologischen Ackerbau sowie mögliche Synergien und Zielkonflikte mit Biodiversitätsbelangen. Die Impulse von Dr. Bernhard Werner und Markus Mücke (beide LWK Niedersachsen) verdeutlichten: Zwischen biodiversitätsorientiertem Handeln und produktionstechnischen Anforderungen bestehen Spannungsfelder, aber auch große Potenziale – insbesondere bei einer frühzeitigen Einbindung in die Anbauplanung. In der Diskussion wurden die Themenfelder Digitalisierung und Züchtung als zentrale Zukunftschancen identifiziert, um Biodiversität und landwirtschaftliche Produktivität stärker miteinander zu verbinden. Die Teilnehmenden sehen in innovativen Technologien und neuen Züchtungsmethoden großes Potenzial, ökologische Nachhaltigkeit und ökonomische Effizienz in Einklang zu bringen. Dabei wurde deutlich: Damit sich neue Verfahren langfristig etablieren können, muss ihre Wirtschaftlichkeit stets mitgedacht und gesichert werden.
Workshop 2 widmete sich strukturellen und organisatorischen Punkten: Nora Kretzschmar (LWK Niedersachsen) stellte die Bedeutung einer Beratung heraus, die neben den betrieblichen Interessen auch landschaftsbezogen plant und berät. Stefanie Bornecke (Landberatung Northeim) unterstrich die Bedeutung einer fachübergreifenden Beratung. Sie machte deutlich: Es gibt punktuell erfolgreiche Projekte, in denen ackerbauliche und Biodiversitätsfragen gemeinsam bearbeitet werden. Es fehlt aber eine strukturelle Verknüpfung der beiden Bereiche. Eine erfahrene und vertrauensvolle Fachberatung, institutionell gut vernetzte Beratungsteams und regional angepasste Konzepte wurden durch die Teilnehmenden als wichtige Kriterien für eine effiziente, praxistaugliche und zielorientierte Beratung identifiziert.
Ausblick
In der abschließenden Podiumsdiskussion wurden die Ergebnisse der Workshops zusammengeführt und evaluiert. Einigkeit bestand darüber, dass Biodiversitätsberatung als Bestandteil der landwirtschaftlichen Beratung gestärkt werden muss – nicht als Zusatzangebot, sondern als Querschnittsthema.
Hilmar Freiherr von Münchhausen zog folgendes Fazit: „Ein nachhaltiger Ackerbau kann nur dann erfolgreich sein, wenn er die Förderung von Biodiversität aktiv mitdenkt. Dafür braucht es eine Beratung, die interdisziplinär aufgestellt ist und in der Lage ist, betriebliche und landschaftliche Anforderungen gleichermaßen zu adressieren.“
„Biodiversitätsförderung in der Agrarlandschaft kann nicht isoliert von den Herausforderungen auf der einzelnen landwirtschaftlichen Produktionsfläche diskutiert werden“, zog Kammer-Vizepräsident Manfred Tannen ein Resümee.

„Deshalb ist es wichtig, sich noch stärker miteinander zu vernetzen und im Dialog nach umsetzbaren und finanzierbaren Lösungen für mehr Artenvielfalt zu suchen, die für die Landwirtschaft auch wirtschaftliche Perspektiven bieten. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, diese Erkenntnisse in die weitere Arbeit im Rahmen des Niedersächsischen Weges einzubringen und damit die wichtige Beratungsarbeit weiter zu unterstützen.“
Die Vorträge des Vormittags – hier zum Download: