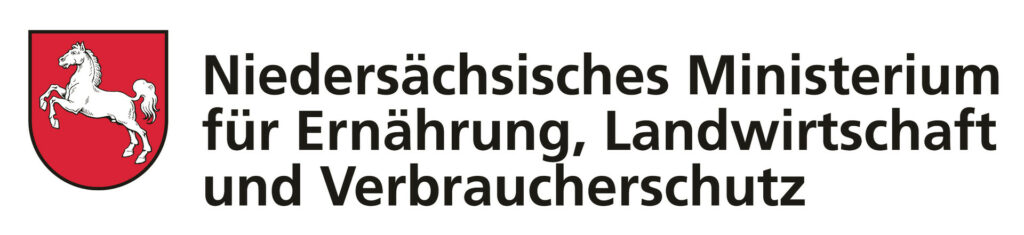Boden im Fokus von Landwirtschaft und Gesellschaft
Workshop zum Umgang mit Bodenverdichtung
KATHARINA BÄUMLER, Dr. BASTIAN STEINHOFF-KNOPP, KAREN PRILOG, Dr. MARCO LORENZ, Dr. MICHAEL KUHWALD, HILMAR FREIHERR VON MÜNCHHAUSEN
Landwirtschaftliche Betriebe, Beratung und Wissenschaft diskutieren in Braunschweig
Der Schutz von Böden zum Erhalt ihrer Funktions- und Leistungsfähigkeit ist essentieller Bestandteil ihrer Bewirtschaftung. Bei der Befahrung von Ackerböden kann es durch zu hohe Lasten bei feuchten und nassen Böden zu irreversiblen Schadverdichtungen kommen. Die oberflächlich sichtbaren Spuren setzen sich im Boden fort: der Porenraum wird reduziert mit negativen Folgen für die Wasserspeicherfähigkeit, Nährstoffverfügbarkeit und Wasserinfiltration. Dadurch kann es zu schlechterem Pflanzenwachstum und zu Ertragsdepressionen kommen.
Die Vermeidung von Bodenverdichtung durch bodenschonendes Befahren ist daher ein wichtiges Ziel im Ackerbau. Wie dies trotz vielfältiger Herausforderungen mit Blick auf ökonomische und gesetzliche Rahmenbedingungen und vor dem hohen Zeitdruck bei Arbeitsspitzen gelingen kann, haben Thünen-Forschende aus dem Projekt SOILAssist mit Praktiker:innen aus Landwirtschaft und Beratung in einem Workshop in Braunschweig diskutiert. Die Veranstaltung am 28.11.2024 wurde gemeinsam mit dem Netzwerk Ackerbau Niedersachsen (NAN) e.V., das Träger des Ackerbauzentrums Niedersachsen ist, organisiert.
Das Potential technischer Lösungen
Ziel des Workshops war es, im Rahmen eines moderierten Austauschs persönliche Erfahrungen sowie Strategien zum Umgang mit Bodenverdichtung zu teilen. Dabei wurden insbesondere Herausforderungen im Hinblick auf die praktische Umsetzung von Methoden zur bodenschonenden Befahrung herausgearbeitet. Beispielsweise wurden starre Terminzwänge diskutiert, die sich aus rechtlichen Vorgaben oder Ernte- bzw. Lieferterminen ergeben können und die teils im Widerspruch zur tatsächlichen Befahrbarkeit der Böden stehen. Auch der Einsatz von technischen Lösungen wie Reifendruckregelanlagen zur Absenkung des Reifeninnendruckes bei Befahrung der Ackerflächen und Tools zur Planung der Feldbefahrung wurden in den Blick genommen. Hierzu wurden im Projekt SOILAssist entwickelte Modellierungen und Planungstools vorgestellt: Ein gemeinsam mit dem KTBL entwickeltes Webtool gibt für die längerfristige Planung eine Einschätzung der Befahrbarkeit auf Grundlage der langjährigen Bodenfeuchte und der Bodenbelastung durch unterschiedliche Maschinen an. Mit einem in das Beratungsinstrument ISABEL des DWD integrierten Befahrbarkeits-Tool können Praktiker:innen die aktuelle Befahrbarkeit auf Grundlage der aktuellen Bodenfeuchte bewerten und erhalten für ihre Planung eine 6-Tage-Vorhersage der Befahrbarkeit. Beide Tools beruhen auf den Arbeiten im Projekt SOILAssist zur Bewertung der Befahrbarkeit in Abhängigkeit von Bodeneigenschaften, Bodenfeuchte und Lasteintrag durch landwirtschaftliche Maschinen („Entscheidungsmatrix Bodenbefahrbarkeit“). Schließlich wurden Lern- und Lehrmedien zum Thema Bodenverdichtung und bodenschonende Befahrung sowie ein aktuell erprobtes Fahrerassistenzsystem vorgestellt. Das Assistenzsystem hilft durch optimale Planung von Routen auf dem Ackerschlag und der dynamischen Anpassung von Maschinenparametern (z. B. optimale Reifendrücke oder Reduzierung der Bunkerfüllung) dabei, die Lasteinträge und negativen Befahrungseffekte zu reduzieren. In diesem Zusammenhang wurde auch die Notwendigkeit unterstrichen, die bodenphysikalischen Folgen der Befahrung von Ackerflächen stärker in der Ausbildung zu berücksichtigen.




Die Spatenprobe bleibt entscheidend für eine individuelle Beurteilung des Bodens
Der Erfahrungsaustausch zwischen den Beteiligten zeigte, dass technische Lösungen zur Vermeidung von Bodenverdichtung auf den Betrieben intensiv diskutiert werden. Einig waren sich die Teilnehmenden, dass technische Tools dabei helfen können, die Befahrbarkeit des Bodens abzuschätzen. Gleichzeitig wurden über Modelle generierte Informationen aber auch kritisch in Bezug auf ihre räumliche Auflösung und die Übereinstimmung mit den lokalen Gegebenheiten auf „dem eigenen Acker“ gesehen. Auch bestanden bei den Praktiker:innen Sorgen, dass das Berücksichtigen von Prognosemodellen zukünftig nicht nur als Entscheidungshilfe gesehen wird, sondern gesetzliche Vorgabe werden könnte.
Neben technischen und digitalen Ansätzen betonten die teilnehmenden Praktiker:innen, dass eine Bewertung der Bodenbefahrbarkeit auch individuell – direkt am Boden und am besten mit einem Spaten in der Hand – erfolgen muss. Man müsse das gesamte Betriebssystem im Blick haben und es so anpassen, dass ein vorsorgender Bodenschutz trotz externen Einschränkungen wie Regulierungen und Lieferterminen möglich ist. Manche Betriebe hätten beispielsweise Fruchtfolgen so angepasst, dass sie von Lohnunternehmen und deren Terminzwängen unabhängig geworden seien. Viele planen zur erfolgreichen Vermeidung von Schadverdichtung auch zeitliche Spielräume für die Durchführung von Feldarbeitsgängen ein und organisieren ihre Erntekampagnen so, dass keine unnötigen Fahrten auf dem Acker stattfinden, insbesondere nicht mit vollem Bunker.
Praxistaugliche Konzepte gemeinsam erarbeiten
Es zeigte sich wie wichtig es ist, zwischen Praktiker:innen in der Landwirtschaft und Beratung sowie der Wissenschaft Ideen zum Umgang mit äußeren Zwängen und praktische Lösungsansätze zu identifizieren. Gleichzeitig kann die Forschung Impulse der landwirtschaftlichen Praxis aufnehmen, um nicht nur die Forschungsagenda besser an die Bedürfnisse der landwirtschaftlichen Betriebe anzupassen, sondern auch um Empfehlungen an die Politik zu formulieren. So gab es viele positive Rückmeldungen dazu, dass die Betriebe untereinander Ideen zum Umgang mit Bodenverdichtung austauschen sowie neue Tools aus der Forschung kennenlernen konnten. Gleichzeitig schätzten die Forschenden das offene Feedback der Teilnehmenden zu ihren Arbeiten.
Der Workshop trägt so zu einem besseren Verständnis der Zielkonflikte und praktischen Probleme im Umgang mit Bodenschadverdichtung und vorsorgendem Bodenschutz bei. Die Ergebnisse werden in laufende Projekte der beteiligten Institutionen und deren Politikberatung einfließen.