Der AgBot im Einsatz - Feldroboter als Fachkraft von morgen?
Rückblick auf den gemeinsamen Praktikertag des Ackerbauzentrums Niedersachsen und des Praxislabors Digitaler Ackerbau der Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Am 2. September 2025 luden das Ackerbauzentrum Niedersachsen und das PraxisLabor Digitaler Ackerbau der Landwirtschaftskammer Niedersachsen zu einem Praktikertag auf die Burg Warberg ein. Zum Auftakt begrüßte Hilmar Freiherr von Münchhausen, Leiter des Ackerbauzentrums Niedersachsen, die Anwesenden und führte in das Thema ein: Können autonome Feldroboter wie der AgBot des niederländischen Unternehmens AgXeed künftig fehlende Fachkräfte ersetzen – oder gar zusätzliche Wertschöpfung für die Landwirtschaft schaffen?
Technische Einblicke
Als erster Referent präsentierte Paul Bühnemann, Produktmanager Feldrobotik bei der AGRAVIS Technik Center GmbH, die technischen Details und Einsatzmöglichkeiten. AGRAVIS vertreibt den AgBot in Deutschland und begleitet die Einführung mit einem breiten Service- und Beratungsnetz.
Zentrale Inhalte seines Vortrags:
- Technische Grundstruktur: Durch Raupenlaufwerke wird der Bodendruck deutlich reduziert, was dem Bodenschutz dient und Erosion minimieren soll.
- Bedienung über die AgXeed-App, Bedienerportal & Fernbedienung: Sie ermöglichen Auftragsplanung, Flächenmanagement, Einmessen von Feldern und Hindernissen sowie Überwachung aus der Ferne.
- Anwendungsbereiche: Stoppelbearbeitung, Saatbettbereitung, Kreiseln, Walzen, Beete formen, Aussaat, Mulchen. Nur im chemischen Pflanzenschutz fehlt aufgrund fehlender gesetzlicher Berücksichtig von Robotik bislang die Einsatzgenehmigung.
- Sicherheitskonzept: Das System erkennt feste und bewegliche Hindernisse (Bäume, Masten, Menschen, Tiere). Beim Rückwärtsfahren bleibt das System funktional –. Allerdings birgt das Rückwärtsfahren Risiken und sollte so weit wie möglich reduziert werden.
- Nutzerfreundlichkeit: Intuitives Bedienkonzept und hohe Präzision – auch mit ISOBUS ausgestattet.
AGRAVIS verfügt bereits über mehr als ein Jahr praktischer Betriebserfahrung und über rund 2.200 Betriebsstunden im Testeinsatz. Paul Bühnemann betonte, dass AGRAVIS dabei auch Probleme und Herausforderungen offen an Kunden weitergibt.



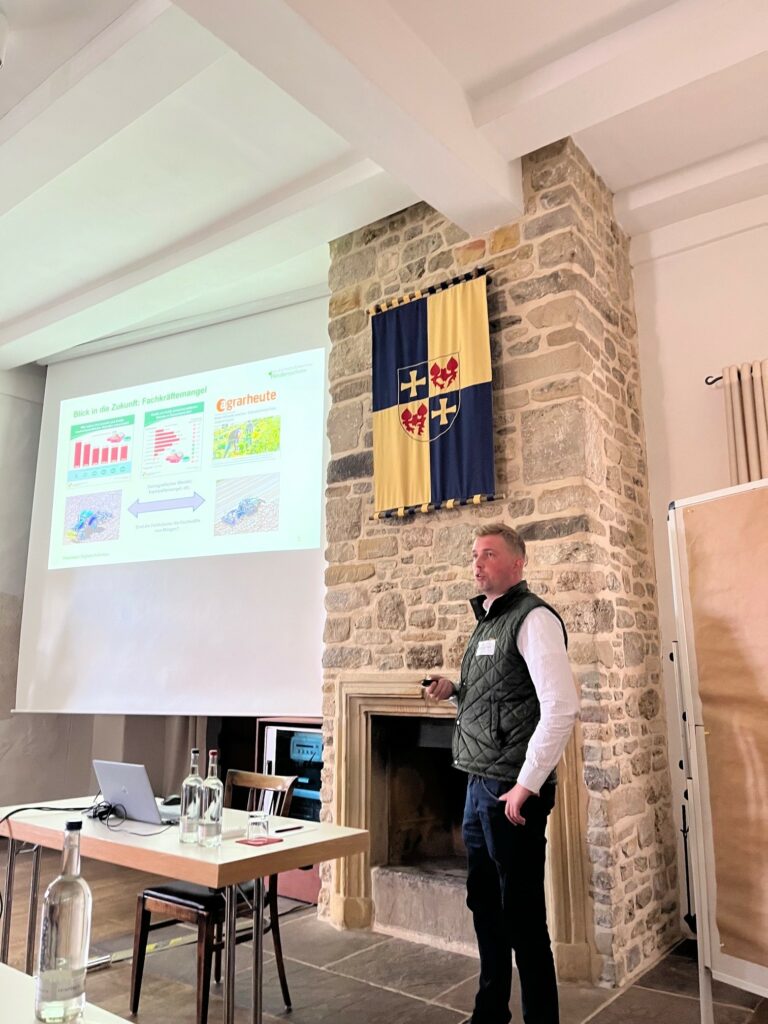
Kosten-Nutzen der Feldrobotik
Im zweiten Vortrag ging es um die Kosten und Nutzen beim Einsatz des AgBots. Dr. Tobias Jorissen forscht an der Hochschule Osnabrück im Rahmen des Digitalen Experimentierfelds Agro-Nordwest zur Wirtschaftlichkeit und Praxistauglichkeit von Feldrobotik. Er hob folgende Punkte hervor:
- Fachkräfte als Treiber: In der Landwirtschaft fehlen zunehmend Arbeitskräfte. Autonome Maschinen können helfen, Zeit und Arbeitskraft einzusparen.
- Dynamischer Markt: Der Feldrobotik-Markt wächst schnell, ist aber technologisch noch jung. Nutzungsdauer und Restwerte der Maschinen sind daher derzeit schwer einzuschätzen.
- Arbeitszeit im Fokus: Mechanische Unkrautregulierung erfordert herkömmlich eine hohe Arbeitsintensität. Roboter können hier entlasten – jedoch fehlen wissenschaftlich verlässliche Arbeitszeitstudien und Langzeiterfahrungen.
- Zur Fragestellung „Wie ist die Kostenstruktur von Feldrobotern und welcher ökonomische Nutzen lässt sich durch ihren Einsatz erzielen?“ wurden am Beispiel von zwei Praxisbetrieben sowie anhand der Analyse von drei Arbeitsverfahren (Kreiseleggen, Maislegen, Maishacken) folgende Modellrechnungen im Maisanbau erarbeitet:
- Ohne Berücksichtigung von Arbeitszeitgewinnen liegen die Maschinenkosten des AgBot mit 46,86 bis 58,92 €/ha noch über denen eines Traktors (37,90 bis 49,96 €/ha).
- Werden jedoch die freigesetzten Arbeitskräfte mit 14,23 €/ha in Ansatz gebracht, sinken die effektiven AgBot-Kosten auf 32,63 bis 44,69 €/ha.
- Daraus ergibt sich ein Nettonutzen von ca. 6,29 €/ha gegenüber dem Traktor – allerdings nur unter der Voraussetzung, dass das Gerät fehlerfrei arbeitet und die gewonnene Zeit sinnvoll genutzt wird.
Sein Fazit: Die Wirtschaftlichkeit der Feldrobotik ist kein Selbstläufer, hängt aber stark von den betrieblichen Gegebenheiten ab. Klar ist: Je größer die Schläge, desto effizienter und günstiger der Einsatz. Für kleinere Flächen mag sich die Technik noch nicht rechnen, doch mit zunehmender Betriebsgröße steigt die Attraktivität rapide.
AgBot im Praxistest
Jobst Gödeke, Leiter des PraxisLabors Digitaler Ackerbau, stellte den Einsatz des AgBots unter realen Bedingungen auf einem Ackerbaubetrieb vor. Das PraxisLabor der Landwirtschaftskammer Niedersachsen ist unweit der Burg Warberg auf der Domäne Schickelsheim (Landkreis Helmstedt) angesiedelt und versteht sich als unabhängige Testplattform für digitale Landtechnik, vergleichbar mit einer „Stiftung Warentest“.
Der AgBot wurde in Arbeitsspitzen bei Stoppelbearbeitung und Saatbettbereitung eingesetzt. Vorteile wie Kompatibilität mit Anbaugeräten, Bodenschonung, gute Wendigkeit sowie eine nahe Serviceunterstützung überzeugten. Gleichzeitig traten Grenzen deutlich hervor:
- keine Straßenzulassung (Tieflader erforderlich)
- hohe Anschaffungskosten (ca. 270.000 € vor 3 Jahren)
- LeistungsProbleme auf schweren Böden und in kupiertem Gelände
- komplexe Vorbereitungsschritte – digitale Konfiguration, Sicherheitsprüfung, Einmessen von Feldern und Geräten
Jobst Gödekes Fazit: „Der AgBot ist kein Alleskönner, aber er erweitert die betrieblichen Möglichkeiten – besonders dort, wo die Arbeitsbelastung hoch ist. Mit zunehmender Reife der Technik werden Feldroboter sehr wahrscheinlich zum festen Bestandteil moderner Ackerbaubetriebe.“
Praktische Vorführung auf dem Stoppelacker
Anschließend ging es gemeinsam aufs Feld. Auf den Flächen von Christian Rosigkeit, Pächter des Gutshofes der Burg Warberg, präsentierte das Team des PraxisLabors Digitaler Ackerbau den AgBot in der Stoppelbearbeitung vor einer Scheibenegge. Es kam der AgBot 5.115T2 zum Einsatz. Er hat einen 156 PS starken Motor, der dieselelektrisch angetrieben wird. Die Teilnehmenden konnten die Funktionsweise direkt am Gerät nachvollziehen und Fragen stellen. Neben Sicherheitsaspekten standen die Bedienung, das Fahrverhalten und die Einsatzgrenzen im Vordergrund. Besonders diskutiert wurde, dass beim Rückwärtsfahren bestimmte Winkelbereiche des Sicherheitssystems nicht vollständig erfasst werden – ein bekanntes Problem, das es auch bei klassisch bemannten Maschinen gibt. Paul Bühnemann betonte hierzu noch einmal, dass es wichtig ist auch die Bevölkerung über die Gefahren des Robotereinsatzes aufzuklären und zu sensibilisieren.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenStimmen zum Abschluss
Zum Ende betonte Hilmar von Münchhausen, dass der AgBot nach seiner Einschätzung das Potenzial hat, künftig eine zuverlässige Unterstützung zu sein. Er blickt gespannt in die Zukunft und stellt fest, dass man sich von den Kosten aktuell noch nicht zu sehr beeindrucken lassen sollte. Er vermutet in der Zukunft eine positive Kosten-/Nutzenentwicklung.
Felicitas Naundorf, die neue Kreislandwirtin im Landkreis Helmstedt, beschloss den Tag mit einem optimistischen Ausblick: Jede technische Innovation beginne mit Skepsis, habe sich aber in der Vergangenheit oft als praktischer Gewinn erwiesen – wie z. B. das Spot Spraying im Pflanzenschutz.
Zum Ausklang des Tages lud die besondere Atmosphäre des Burghofs zu einem gemeinsamen Abendessen ein. In entspannter Runde nutzten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit, die Eindrücke des Praktikertages zu vertiefen und offene Fragen im persönlichen Gespräch weiterzuführen. Dabei wurde nicht nur über den AgBot diskutiert, sondern auch über allgemeine Herausforderungen und Perspektiven des modernen Ackerbaus. Dieser informelle Austausch rundete die Veranstaltung ab und bot den idealen Rahmen, Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen zu teilen.
Fazit
Der Praxistag auf Burg Warberg verband Theorie und Praxis rund um Chancen und Herausforderungen der Feldrobotik. Der AgBot ist heute noch kein vollständiger Ersatz für einen Standardtraktor, bietet aber schon jetzt wertvolle Entlastung – besonders auf größeren Schlägen. Mit wachsender Erfahrung, technischer Reife und fallenden Kosten hat er das Potenzial, zu einer wichtigen „Fachkraft von morgen“ im modernen Ackerbau zu werden.
