Hilmar Freiherr von Münchhausen, Geschäftsführer des Netzwerks Ackerbau Niedersachsen e.V. und Leiter des Ackerbauzentrums auf der Burg Warberg, traf die niedersächsische Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Barbara Otte-Kinast und sprach mit ihr über Ackerbau, Nachhaltigkeit und die Arbeit des Ackerbauzentrums:
Sehr geehrte Frau Ministerin, im August 2021 habe ich begonnen, das Ackerbauzentrum auf der Burg Warberg aufzubauen. Was hat Sie motiviert, ein Ackerbauzentrum ins Leben zu rufen?
Die Landwirtschaft steht nicht nur in Niedersachsen, sondern in ganz Deutschland und Europa vor einem gewaltigen Umwälzungsprozess. Wir haben große gesellschaftliche Erwartungen an die Arbeit der landwirtschaftlichen Betriebe, gerade mit Blick auf den Umwelt- und Naturschutz. Daneben wird die Landwirtschaft durch sich verändernde agrarpolitische Rahmenbedingungen und die Situation auf den Agrarmärkten gefordert. Niedersachsen ist ein bedeutendes Agrarland, in dem der Ackerbau mit rund 1,9 Millionen Hektar eine besonders große Rolle spielt – in ökonomischer wie auch ökologischer Hinsicht. Dabei ist der Ackerbau in Niedersachsen unter anderem durch eine regional stark ausgeprägte Heterogenität und einen häufig hohen Spezialisierungsgrad geprägt. Um die vor uns liegenden Herausforderungen zu meistern, habe ich eine Niedersächsische Grünland- und Ackerbaustrategie auf den Weg gebracht. Das Ackerbauzentrum soll dabei helfen, diese Strategie umzusetzen.
Welche Rolle spielt dabei der Niedersächische Weg?
Der Niedersächsische Weg baut die Brücke zwischen der Landwirtschaft und dem Umwelt- und Naturschutz. Er setzt auf Konsens zwischen den Akteuren und auf einen fairen Ausgleich, den Landwirte brauchen, wenn sie über die gesetzlichen Anforderungen hinaus ökologische Leistungen erbringen. Ich bin stolz darauf, dass wir es in Niedersachsen gemeinsam mit Vertretern der Landwirtschaft und der Umweltverbände geschafft haben, dass miteinander und nicht gegeneinander geredet wird. Und jetzt müssen wir gemeinsam dafür sorgen, dass im Rahmen der Europäischen Agrarpolitik über Agrarumweltmaßnahmen oder auch die Ökoregelungen Geld an diejenigen Landwirte fließt, die mit der Natur wirtschaften und neben hochwertigen Lebens- und Futtermitteln auch den Umwelt- und Naturschutz fördern und die Artenvielfalt steigern.
Wo sind aus ökologischer Sicht besondere Anstrengungen notwendig?
Wir müssen bei der Düngung und beim Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel noch effizienter werden als bisher. Insbesondere sensible Ökosysteme wie Gewässer müssen besser geschützt werden. Dabei werden uns technische Innovationen ebenso helfen wie ein besseres Management u.a. bei der Verteilung von Wirtschaftsdünger. Den haben wir im Nordwesten im Überfluss und in den vieharmen Regionen zu wenig! Handlungsbedarf haben wir auch bei den Fruchtfolgen. Wenn in Niedersachsen auf über 50 Prozent des Ackerlandes nur zwei Kulturen stehen, nämlich Winterweizen und Mais, ist das aus ökologischer Sicht zu hinterfragen. Weite Fruchtfolgen verbessern die Bodenfruchtbarkeit, wirken sich positiv auf die Funktion von Ackerbaulandschaften für die Artenvielfalt aus und verhindern auch, dass es zu Resistenzen bei Unkräutern kommt.
Heißt das flächendeckend in der Landwirtschaft Stickstoffdünger und chemische Pflanzenschutzmittel reduzieren?
Über welche Instrumente lässt sich ein nachhaltiger Ackerbau fördern?
Wir müssen zukünftig viel komplexer denken. Die Agrar- und Umweltpolitik gibt gern Anreize, um gesellschaftlich nachgefragtes Handeln zu honorieren und bedient sich als letztem Mittel auch gesetzlicher Vorgaben. Doch das reicht nicht. Wir müssen stärker in Marktmechanismen denken und die gesamte Wertschöpfungskette berücksichtigen. Auch auf den Finanzmärkten gibt es Bestrebungen, das Thema Nachhaltigkeit mit der Vergabe von Krediten zu verknüpfen. Das wird auch auf die Landwirtschaft zukommen. Und wir müssen in Bildung investieren und technische Innovationen befördern. Die Digitalisierung in der Landwirtschaft bietet große Potentiale und steht noch ganz am Anfang. Dies ist vor allem eine Aufgabe der Landtechnik, aber die Politik muss die Infrastruktur bereitstellen, damit Innovationen auch praktisch umgesetzt werden können. Ich nenne hier nur 5 G als Stichwort. Fazit: Wir brauchen eine Einigkeit über das Ziel. Die Wege dorthin werden vielfältig sein!
Zurück zum Ackerbauzentrum: Wo sehen Sie die maßgeblichen Aufgaben, die dort angepackt werden sollten?
Wir haben in Niedersachsen bedeutende und hervorragend funktionierende Institutionen der Landwirtschaft und ihrer Interessenvertretung. Auch das Versuchswesen ist gut ausgebaut. Wir haben großartig arbeitende wissenschaftliche Einrichtungen und Universitäten. Das Ackerbauzentrum braucht all dies nicht zu duplizieren – das wäre auch gar nicht leistbar. Was es jedoch braucht, ist eine bessere Vernetzung der Akteure und der Projekte. Und eine bessere Kommunikation der Ergebnisse. Hier sehe ich Aufgaben des Ackerbauzentrums im Sinne einer Plattform für Information, Dialog und Kommunikation. Darüber hinaus bietet es sich durch den Standort auf der Burg Warberg an, Veranstaltungen in verschiedenen Formaten zu organisieren. Vom Strategiegespräch über die Fachtagung bis hin zu einem öffentlichkeitswirksamen Event für alle an der Landwirtschaft interessierten Bürger.

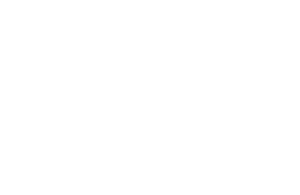
Wir haben im Wahlkampf Frau Otte-Kinast als sehr engagierte, kompetente und volksnahe Politikerin erlebt. Es freut mich sehr für Sie, dass sie über die Liste nun auch als Abgeordnete für Bad Pyrmont für unsere Anliegen ein Ohr hat. Noch mehr freut es mich, dass sie als Oppositionspolitikerin zukünftig das wichtige Amt des stv. Landtagspräsidenten bekleidet. Das zeigt die Anerkennung, die sie sich erarbeitet hat. Als Europa-Union freut uns, dass sie sich entschlossen hat, die nieders. Europapolitik besonders als Schwerpunktthema weiterzuentwickeln. Dazu gehört dann sicher auch die europaweit abzustimmende nachhaltige Agrarwende. Ja, wir brauchen dringend mehr Dialog zwischen landwirtschaftlichen Lebensmittel-Erzeuger und dem Verbraucher. Besonders Städter fehlt jedes reale Verständnis für Tierwohl und Pflanzenschutz. Aus Unkenntnis heraus und falsch verstandener Tierliebe entstehen gesellschaftliche Barrieren, die am Ende in radikalen Befreiungsaktionen oder kriminellen Aktionismus enden. Mit Ihrem Ackerbauzentrums auf der Burg Warberg ist hier eine Einrichtung geschaffen worden, die vermitteln kann. Ich hoffe, die neue Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) ebenso gute Arbeit leistet. Ihr grüner Vorgänger Christian Meyer hat sich als Beratungsresistent und störrisch erwiesen und blieb nicht in guter Erinnerung! Sein Einfluss wird sich aus dem Umweltministerium heraus allerdings auch in der Landwirtschaft und Ackerbau bemerkbar machen. Beide Ministerien werden zukünftig enger zusammenarbeiten und liegen in der Hand der niedersächsischen Grünen, die zur industriellen und mittelständigen Landwirtschaft ein gestörtes Verhältnis haben. Ich bin gespannt und sehe für Sie viel Aufklärungsarbeit!
Sehr geehrter Herr Klüter,
das Ackerbauzentrum Niedersachsen steht mit der neuen Landwirtschaftsministerin, Miriam Staudte, in einem engen Austausch und wird seine Arbeit für einen nachhaltigen Ackerbau weiter engagiert fortsetzen!
Mit freundlichen Grüßen
Hilmar Freiherr von Münchhausen